Bibliotheken & Archive: Über Open Science und Citizen Science mit Martin Munke
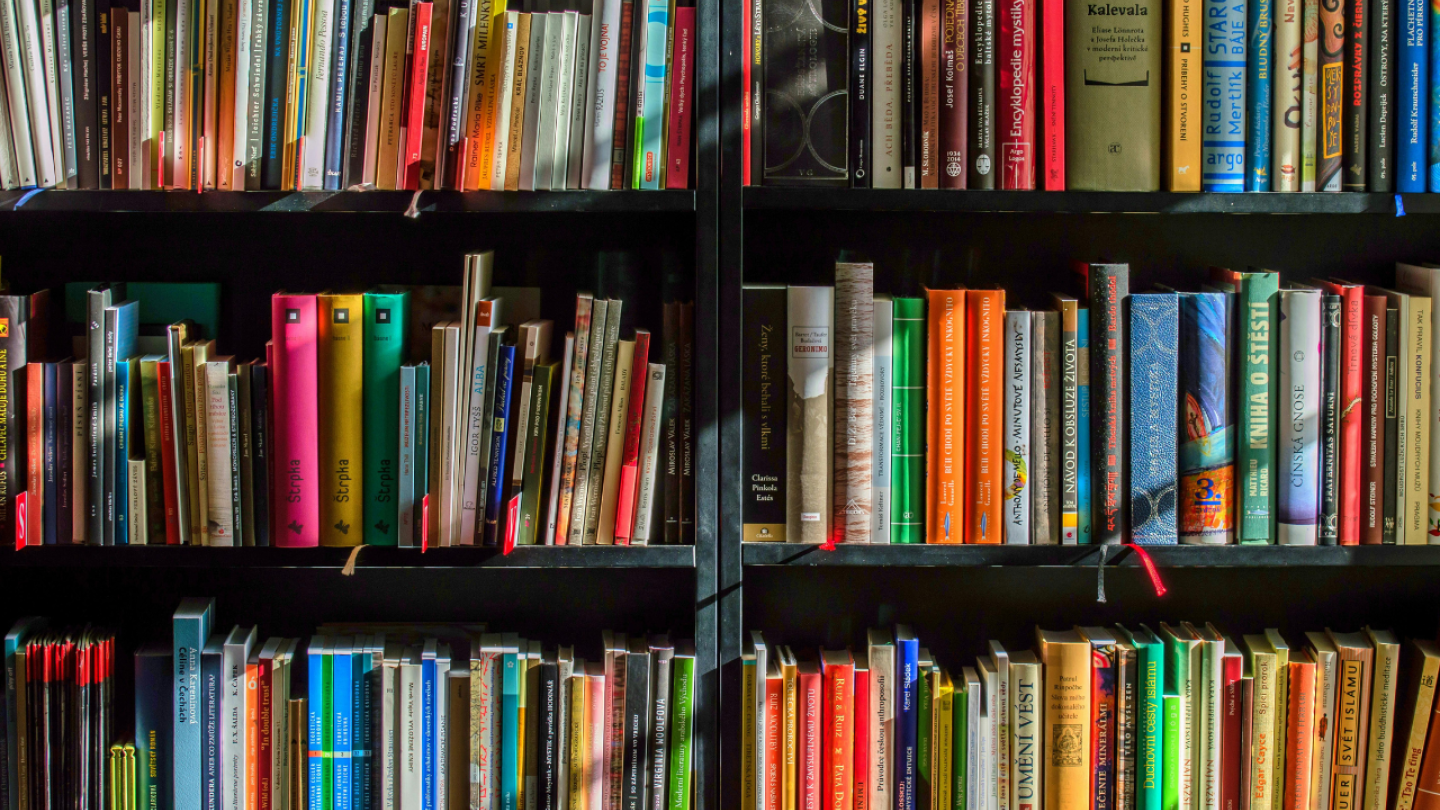
Welche Rolle spielt Citizen Science heute in Leitbildern und Selbstverständnis von Forschungsbibliotheken? Darüber haben wir mit Martin Munke, Referatsleiter Saxonica und Kartensammlung sowie Ansprechpartner für Citizen Science an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), gesprochen.
Warum hat sich die SLUB dem Prinzip Open Science verschrieben? Und welche Aktivitäten führt sie in dem Bereich durch?
Munke: Es gibt da ein schönes Zitat: „Open science is just science done right“. Das fasst unsere Motivation sehr gut zusammen. Der Zugang zu Forschungsergebnissen wird immer teurer, dabei ist akademische Forschung in der Regel durch Steuergelder finanziert und besonders in Bibliotheken sollte der Zugang zu Forschungsliteratur nicht kostenpflichtig sein. Open Science ist ein Ansatz, dem entgegenzuwirken. Ein weiterer Punkt für uns ist, dass Wissen transparent und nachvollziehbar sein sollte. Das kann Forschende vor Herausforderungen in ihrer Arbeitsweise stellen. Als Infrastruktureinrichtung sind wir dafür da, dabei zu unterstützen und zu begleiten. Ganz konkret haben wir Räume wie das Open Science Lab, die Menschen für ihre Forschung nutzen können, und wir bieten Beratung, Services und Tools an. Bei uns im Haus setzen auch wir einen Schwerpunkt auf Open Source Software, beraten dazu und nutzen diese selbst. Außerdem führen wir eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Open Science durch, meist mit Partner*innen. Und natürlich bemühen wir uns, unsere eigenen Inhalte unter möglichst offenen Lizenzen bereitzustellen.
Welche Rolle spielt Citizen Science als Aspekt von Open Science bei euch?
Munke: Als Landes- und Universitätsbibliothek haben wir sowohl einen Schwerpunkt auf akademischer als auch auf nicht-akademischer Forschung. Citizen Science, also nicht-akademische Forschung, adressieren wir mit unseren Angeboten daher genauso wie akademische Forschung. Open Science hat den Anspruch inklusiv zu sein – Citizen Science ist da vom Ansatz her besonders gut drin. Das ist ein Fokus der uns im Open Science Kontext auch sehr wichtig ist. Unsere eigenen Citizen-Science-Projekte sind inhaltlich vor allem im Bereich Citizen Humanities angesiedelt, also geisteswissenschaftliche Projekte. Organisatorisch und methodisch haben unsere Projekte eine starke digitale Komponente und nutzen vor allem den Ansatz des Crowdsourcings. Sie sind meist bestandsbezogen, es geht zum Beispiel um die Digitalisierung und Transkription historischer Quellen wie beim Dresdner Totengedenkbuch oder um die Georeferenzierung historischer Karten im Virtuellen Kartenforum.
Abseits von unseren eigenen Projekten ist es uns wichtig, Akteure sowohl aus der Zivilgesellschaft als auch aus der akademischen Forschung im Bereich Citizen Science zu unterstützen. Dafür stehen wir mit Beratung zu Tools und Methoden zur Verfügung oder helfen bei Fragen zum Community Building. So haben wir beispielsweise die Projekte Colouring Dresden oder #FetzigesGeschichtszeugs begleitet.
Aber Citizen Science ist bei uns viel mehr als nur Projekte. Gerade im Bereich der Geschichtswissenschaften hat man viel Bezug zu den Heimatforschenden, die ehrenamtlich die Geschichte ihrer Region erforschen. Für diese stellen wir Bestände zur Verfügung, geben Kurse und bieten Beratung – vor allem mit Blick auf die Nutzung der offenen Infrastrukturen des Wikiversums, was bei uns unter dem Stichwort „Open Citizen Science“ läuft. Wir haben im Haus zum Beispiel einen Wikisource-Beratungsstand, der direkt aus der Community bespielt wird. Auch für die Beratungsangebote für Familienforschung arbeiten wir mit Ehrenamtlichen zusammen, hier vom Dresdner Verein für Genealogie. Außerdem bieten wir Publikationsmöglichkeiten: Citizen Scientists können unter anderem auf dem Blog unseres Landeskundeportals Saxorum frei zugängliche Artikel veröffentlichen.
Gibt es eine Art Peer-Review-Verfahren oder andere Mechanismen zur Sicherung akademischer Standards, wenn Citizen Scientists über die Möglichkeiten der SLUB publizieren?
Munke: Das ist ganz unterschiedlich. Auf unserem Blog haben wir ein Editorial Review. Dort versuchen wir im Bereich unserer Expertise die Qualität der Artikel einzuschätzen. In seltenen Fällen leiten wir Artikel an Kolleg*innen an der Universität für eine Zweitmeinung weiter. Bei Veröffentlichung auf dem Publikationsserver Qucosa wird es eher formal eingeschätzt, also geschaut ob es Nachweise gibt und wissenschaftliche Literatur verwendet wird. Eine inhaltliche Prüfung können wir da nicht leisten. Wir überlegen aber, wie wir diese Services weiterentwickeln können, um gereviewte Publikationen in unseren Publikationssystemen genauer auszuzeichnen. Dafür müssten wir ein Netzwerk akademischer Akteure etablieren, die bereit sind, Veröffentlichungen aus dem Bereich Citizen Science zu prüfen und sich da zu engagieren. Aktuell versuchen wir vor allem durch unsere Schulungen den ehrenamtlich Forschenden das Handwerkszeug mitzugeben, valide wissenschaftlich zu arbeiten. Letztendlich ist die Qualitätseinschätzung aber die Verantwortung derer, die die Literatur rezipieren.
Du hast vorhin erwähnt, dass ihr gerade im Bereich Citizen Science mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert. Welche Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben sich dadurch?
Munke: Möglichkeiten liegen zum einen darin, dass bereits bestehende Communities, die Expertise in bestimmten wissenschaftlichen Feldern haben, über Multiplikatoren wie Vereine relativ einfach für Projekte aktiviert werden können. Auf Seiten der zivilgesellschaftlichen Organisationen und ihrer Mitglieder gibt es unglaublich viel Spezialwissen und im Idealfall können wir gegenseitig von unseren unterschiedlichen Expertisen profitieren. Als Bibliothek können wir zum Beispiel Räumlichkeiten bereitstellen, die für kleine Vereine nicht realisierbar wären, andersherum bringen die Vereine Tools oder Frameworks mit, auf die wir in Kooperationen zurückgreifen können. Der Verein für Computergenealogie betreibt zum Beispiel ein Dateneingabesystem für die strukturierte Erfassung von historischen Quellen, das sich seit vielen Jahren in partizipativen Projekten bewährt hat.
Aber natürlich gibt es auch Herausforderungen. Die Wissenschaft bringt hohe Anforderungen mit sich, die besonders aus ehrenamtlicher Perspektive schwer umsetzbar sein können. Da gibt es einen hohen Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf, vor allem mit einer steigenden Zahl an Partner*innen. Auch eine gemeinsame Sprache zu finden, kann herausfordernd sein. Das sieht man auch ganz gut an dem Begriff „Citizen Science“ oder „Bürgerwissenschaften“. Viele Ehrenamtliche verstehen den Begriff nicht oder fühlen sich nicht angesprochen. Mit den dahinterstehenden Konzepten können wir die Leute aber durchaus erreichen, wir müssen uns also überlegen, wie wir sie benennen, um diese Menschen nicht zu verschrecken.
Als Co-Autor des Weißbuchkapitels „Archive, Bibliotheken, Museen und Wissenschaftsläden“ hast du für das Jahr 2030 die folgende Vision mitformuliert: „Citizen Science ist als Forschungs- und Transferansatz ein fester Bestandteil in den Leitbildern und im Selbstverständnis von Institutionen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit zur aktiven Zusammenarbeit mit Bürger*innen.“ Inwieweit ist diese Vision an der SLUB bereits verwirklicht und wo gibt es noch Potenziale?
Munke: In unserem aktuellen Strategiepapier SLUB 2025 wird Citizen Science erwähnt, spielt jedoch keine zentrale Rolle. Wir haben also schon jetzt eine gewisse institutionelle Verankerung, die aber aus meiner Perspektive durchaus noch stärker sein könnte. Gerade haben wir den Prozess für die Strategie SLUB 2030 gestartet. Ziel ist es, das Thema dort zentraler und verbindlicher zu platzieren, auch mit Verweis auf das Weißbuch. Im Selbstverständnis der SLUB ist Citizen Science nach meiner Wahrnehmung bereits stärker vertreten, als es die Strategie sagt, das sieht man auch darin, dass es Stellenanteile für den Bereich gibt. In den letzten fast zehn Jahren haben wir Citizen Science zunehmend in den Mittelpunkt gerückt, ein stabiles Netzwerk aufgebaut und eine hohe Sichtbarkeit unserer Aktivitäten erreicht. Das führt umgekehrt aber auch dazu, dass wir bei Anfragen und Kooperationswünschen an unsere Kapazitätsgrenzen kommen. Da wäre noch Luft nach oben. Mit unseren eigenen Projekten sind wir aktuell vor allem auf dem Crowdsourcing-Level aktiv, auch aus Kapazitätsgründen. Für die Zukunft ist es durchaus denkbar, darüber hinaus zu gehen.
Lass uns einmal über die SLUB hinausschauen. Wie etabliert ist Citizen Science an Forschungsbibliotheken in Deutschland? Seid ihr mit anderen Bibliotheken zu diesem Thema im Austausch oder gibt es sogar strategische Vernetzung?
Munke: Das Thema ist noch im Kommen. Vor zehn Jahren gab es an Forschungsbibliotheken nichts, was unter dem Label „Citizen Science“ gelaufen ist (auch wenn Partizipation natürlich schon lange ein Thema an Bibliotheken ist), und im Grünbuch wurden Bibliotheken als Akteure in diesem Bereich auch noch nicht adressiert. Das zeigt, was sich alles in den letzten Jahren getan hat. Die Projektzahl nimmt zu und wir bekommen mehr Anfragen aus anderen Einrichtungen bezüglich unserer Erfahrungen. Auch die Literatur zu Bürgerwissenschaften und Bibliotheken wächst an. Citizen Science ist inzwischen als Thema in bibliothekarischen Studiengängen angekommen und es gibt immer mehr Abschlussarbeiten dazu. Viel passiert auch außerhalb Deutschlands: Es gibt vermehrt Foren und Netzwerke, wo sich Archive, Bibliotheken und Museen austauschen. Auf der europäischen Ebene gibt es zum Beispiel eine Citizen Science Working Group bei der Association of European Research Libraries (LIBER), in der auch viele deutschsprachige Kolleg*innen aktiv sind. Die arbeiten gerade an einem mehrteiligen Citizen Science Guide, die ersten Hefte sind bereits erschienen. Auf der nationalen Ebene in Deutschland gibt es noch kein festes Forum für die strategische Zusammenarbeit von Bibliotheken im Bereich Citizen Science.
Welche Bedarfe gibt es auf strategischer Ebene, damit sich die Vision aus dem Weißbuch verwirklichen kann und Citizen Science fester Bestandteil in Leitbildern und im Selbstverständnis von Forschungsbibliotheken wird?
Munke: Wichtig ist zum einen, dass auch die Universitäten selbst Citizen Science noch stärker als Thema für sich begreifen. Die Universitätsbibliotheken sind ja im Endeffekt nachgelagerte Einrichtungen, die das dann mit adressieren könnten. Open Science kann da auch ein Vehikel sein, die Bedeutung von Citizen Science noch zu stärken. Es könnte zudem sinnvoll sein, gemeinsame Kontaktstellen für Citizen Science an Universitäts- und Forschungs- oder Landesbibliotheken zu etablieren. Das würde einen Single Point of Entry für Forschende bieten, wenn sie sich zu Bürgerwissenschaften informieren wollen. Ein weiterer Punkt wären niedrigschwellige Wettbewerbe, wie es Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt war, aber auch eine Verstetigung in den großen Förderlinien wie denen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Finanzielle Ressourcen steigern auch die Motivation, in dem Bereich etwas zu machen. Außerdem müssen wir versuchen, bei zivilgesellschaftlichen und kommunalen Akteuren ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Citizen Science ein guter Ansatz ist, um kommunale Zukunftsfragen zu adressieren. Diese Synergien zu betonen und aufzuzeigen, dass Bibliotheken das Potenzial haben zu unterstützen, als Anlaufpunkte zu dienen und Akteure zusammenzubringen, wäre sehr wichtig.
